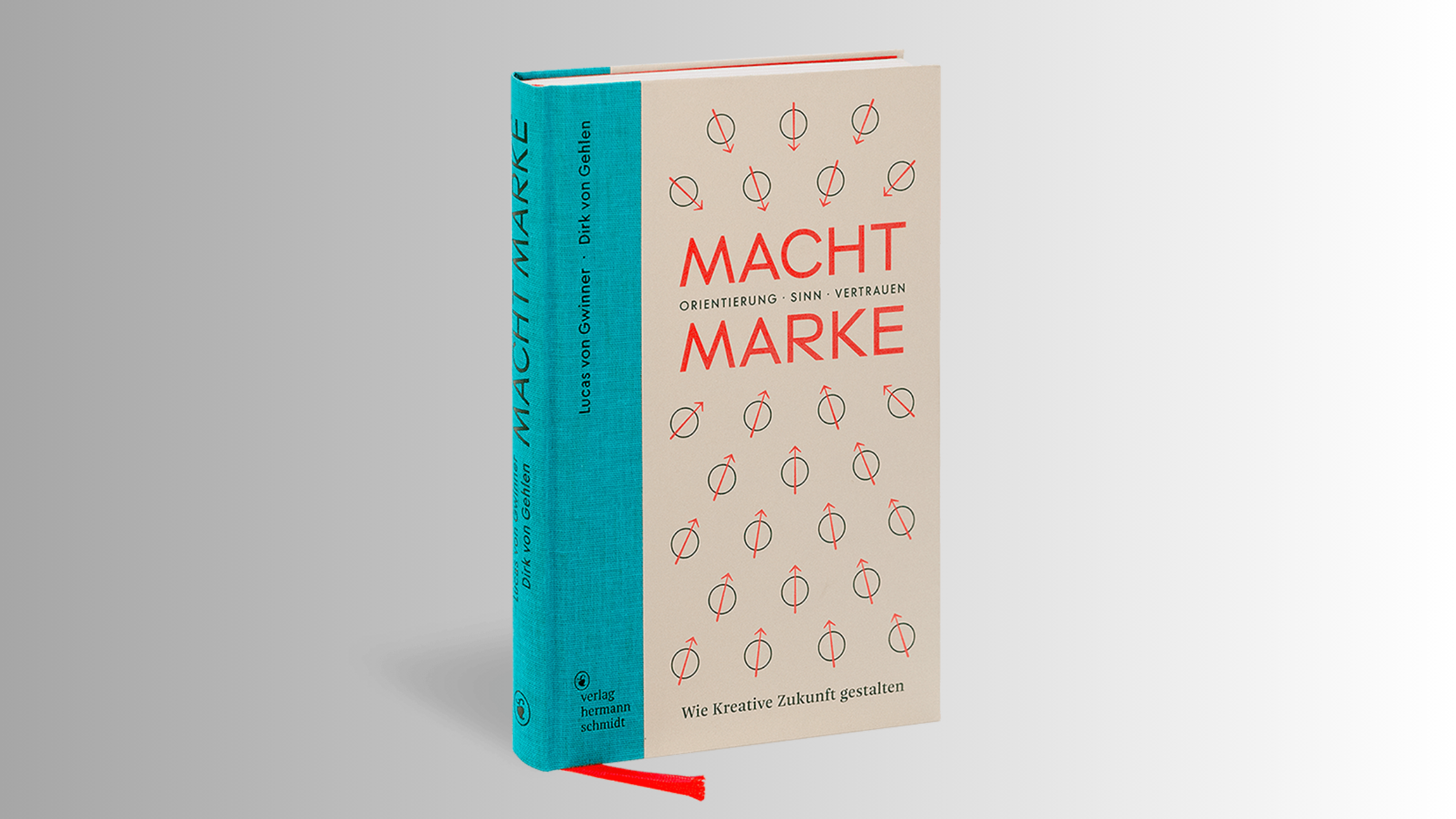„Macht Marke“ ist ein inspirierendes Buch über Markenentwicklung im Zeitalter der digitalen Kommunikation. Rezension und Gespräch mit Lucas von Gwinner, einem der beiden Autoren.
Wissenschaft und Bildung als Marke – ist das sinnvoll? Ja – zumindest, wenn man einer Idee von Marke folgt, die sich im Vergleich zu klassischen Vorstellungen in den letzten Jahren gewandelt hat. Marke zielt auf die Identität, auf Werte und Visionen einer Organisation, egal, ob sie Forschung und Lehre verantwortet, Bildungsangebote vermittelt oder Batterien herstellt. Die Reduktion von Marke auf die schöne Verpackung ist längst überholt. Marken machen einen Unterschied. Sie geben Orientierung, vermitteln Zugehörigkeit und verdeutlichen, wofür eine Organisation steht. Sie erreichen also genau das, was auch für das Gelingen von Wissenschafts- und Bildungskommunikation notwendig ist. Denn in Zeiten eines Überangebots an Informationen, die immer schwieriger zu bewerten sind, haben Marken das Potenzial, über den Austausch und Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen Vertrauen zu schaffen.
Marke als Kompass in Veränderungsprozessen
Lucas von Gwinner und Dirk von Gehlen haben ein Buch über Marke geschrieben, das dieses Verständnis sehr anschaulich erklärt und in klaren Aussagen auf den Punkt bringt: „Marke ist kein Zuckerguss, sondern die ganze Torte“, heißt es zum Beispiel, um mit dem Missverständnis der Oberflächlichkeit aufzuräumen. Dabei gehen sie sogar noch einen Schritt weiter: Markenentwicklung bedeute nicht nur die Kreation von Identität, schreiben sie, sondern der Prozess sei zugleich ein sehr effektives Instrument für Change-Management und Transformation in Organisationen. Denn Marke gebe eine gemeinsame Richtung vor, helfe im besten Fall dabei, dass in einem Unternehmen alle an einem Strang ziehen.

Aus der Praxiserfahrung
Es gibt eine unüberschaubare Anzahl von Büchern über Markenentwicklung, mit einer Vielzahl von theoretischen Modellen und Tools, die in der Praxis zum Einsatz kommen können. Für die konkrete Beratung ist das oft nur bedingt hilfreich – zusammen mit Marcus Flatten habe ich in den letzten Jahren deshalb für unsere gemeinsamen Beratungsprojekte ein eigenes Modell entwickelt. Wir folgen in den wesentlichen Punkten dabei den Überlegungen, die in „Macht Marke“ zu lesen sind.
Das Buch kommt direkt aus der Praxis – und strahlt genau das auf jeder Seite aus. Lucas von Gwinner arbeitet seit über zwanzig Jahren in der Markenberatung, kennt die Perspektive als Berater genauso wie die des Verantwortlichen in einem Unternehmen – er ist Leiter für Marketing und Digitales beim Fensterhersteller Finistral in Südtirol. Dirk von Gehlen, Journalist und Director Think Tank am SZ-Institut, beschreibt als Experte für digitale Transformation von Kultur, Gesellschaft und Unternehmen die besonderen Rahmenbedingungen, die im Ringen um Aufmerksamkeit heute zu berücksichtigen sind. Sie haben die Bedeutung von Marken in unserer Kommunikation noch einmal deutlich verstärkt.
Die Marke finden
„Macht Marke“ zeichnet in einzelnen Schritten nach, wie sich ein Beratungsprozess planen lässt, und bietet mit einigen Checklisten und Tabellen bei der Umsetzung konkrete Hilfestellungen an. „Marke ist Chefinnensache“ ist nur einer der wichtigen Hinweise, die dabei zu beachten sind. Denn wer Marke als Führungsinstrument ernst nimmt, sollte natürlich die Führungskräfte im Boot haben.
Ist externe Beratung dann überhaupt noch gefragt? Ja, sie sei unabdinglich, heißt es im Buch. Denn jede Organisation brauche Unterstützung bei der Steuerung und immer wieder auch die Perspektive von außen – schon allein deshalb, um „den Wald vor lauter Bäumen“ zu erkennen. Es gibt viele Aussagen in diesem Buch, die ich unterschreibe, diese besonders:
“Beratung sorgt durch die Erfahrung mit vergleichbaren Prozessen für mehr Sicherheit und Disziplin im gesamten Projekt. Dabei sollte die Rolle der externen Begleiter jedoch auch nicht überschätzt werden, denn der wesentliche Teil der Aufgabe liegt immer bei der Unternehmung: Nur die Organisation selbst hat tiefe Erfahrung in ihrem Geschäft und kennt alle Zahlen, Daten und Fakten zu ihren Angeboten und Leistungen. Externe begleiten Projekte, doch die Organisation selbst wird auch anschließend in voller Intensität an ihrem Angebot arbeiten.”
(„Macht Marke“, Seite 87)
Und auch dafür bieten die Autoren eine schöne Formel an: „Marke finden, nicht erfinden“.
Eine klare Empfehlung
Neben einer klaren Haltung zu Theorie und Praxis der Marke trägt auch die gelungene, ansprechende Gestaltung dazu bei, dass „Macht Marke“ zu dem Buch wird, das ich als Fachbuch wirklich gerne gelesen habe. Ich empfehle es auch deshalb allen, mit denen ich arbeite, weil ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, mit einem einheitlichen Verständnis von Marke in die gemeinsame Arbeit zu starten.
Gespräch mit Lucas von Gwinner
Bei aller Zustimmung gibt es jedoch auch ein Wort, über das ich im Text gestolpert bin – und zwar im folgenden Satz: „Der zentrale Kniff, um Kommunikationswirkung zu erzielen, ist die Zuspitzung bis zur kalkulierten Übertreibung.“ (S.133)
Lucas von Gwinner hat sich im April die Zeit genommen, mit mir unter anderem genau über diese Zuspitzung zu sprechen — was mich sehr gefreut hat. Das war eine schöne Gelegenheit, sich noch einmal auszutauschen. Wir haben unser Gespräch aufgenommen, hier ist es direkt zu hören:
Tl;DL
Wer nicht alles hören mag, hier der Spoiler in Kürze: Bei dem Wort “übertreiben” sind wir nicht ganz auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Beziehungsweise haben wir festgestellt, dass es wirklich auf Feinheiten ankommt. Denn hier bewegt sich die Markenkommunikation auf einem ganz schmalen Grat zwischen Pointe setzen und wahrhaftig bleiben. Lucas ist es wichtig, dass Markenkommunikation nicht relativiert. Er betont deshalb, wie notwendig es ist, zuzuspitzen und das Schillernde herauszukitzeln: um Aufmerksamkeit zu finden, Typik herzustellen und Bekanntheit zu erreichen. Ich stimme ihm darin zu, glaube aber, dass es dafür keine Übertreibung braucht, denn: „Nichts ist erregender als die Wahrheit“ (Egon Erwin Kisch).
Am Ende liegen wir gar nicht so weit auseinander. Vielleicht liegt der Unterschied einfach auch in unseren jeweiligen Themengebieten. Ich würde für die zugespitzte, überraschende und auch pointierte Aussage schon deshalb nicht die Übertreibung wählen, weil hier in der Wissenschaftskommunikation eine Grenze liegt. In den Leitlinien der guten Wissenschaftskommunikation ist das unter anderem definiert — und ich folge ihnen. Und vielleicht sind wir über das eine Wort zu einem Unterschied gekommen, der die Kommunikation für Fenster oder Batterien dann doch von der Wissenschaftskommunikation unterscheidet.